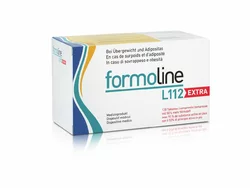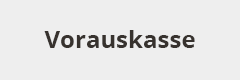Enzephalitis
Achtung bei Kopfschmerzen und diesen Symptomen
editorial.overview
Was ist eine Enzephalitis (Gehirnentzündung)?
Eine Enzephalitis, auch Gehirnentzündung genannt, ist eine Entzündung des Gehirngewebes, die durch Viren, Bakterien, Pilze oder das eigene Immunsystem ausgelöst werden kann. Diese Entzündung kann verschiedene Teile des Gehirns betreffen und zu neurologischen oder kognitiven Störungen führen, die sich beispielsweise in Verhaltens- oder Denkstörungen äussern.
Die Blut-Hirn-Schranke schützt das Gehirn in der Regel vor Krankheitserregern, doch manche schaffen es, diese Barriere zu überwinden und eine Enzephalitis zu verursachen. In schweren Fällen kann das Gehirngewebe anschwellen und zu dauerhaften Schäden oder sogar Hirnblutungen führen.
Eine besondere Form ist die Meningoenzephalitis, bei der neben dem Gehirn auch die schützenden Hirnhäute entzündet sind.
Wie lindern Sie heute Kopfschmerzen?
Was sind die Symptome einer Enzephalitis?
Die Symptome einer Gehirnentzündung können je nach Ursache, Schweregrad der Erkrankung, betroffener Gehirnregion und der allgemeinen Verfassung des betroffenen Menschen sehr unterschiedlich sein. Häufig treten zunächst allgemeine Beschwerden auf, die sich anschliessend zu spezifischeren neurologischen Symptomen entwickeln.
Zu Beginn zeigen sich meist unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, hohes Fieber und grippeähnliche Beschwerden wie Abgeschlagenheit, Übelkeit und Erschöpfung.
Mit dem Fortschreiten der Erkrankung treten häufig Verwirrtheit und Bewusstseinsstörungen, die von Benommenheit bis zum Koma reichen können, sowie Konzentrationsschwierigkeiten und Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnisses. Oft kommt es auch zu Veränderungen des Verhaltens oder der Persönlichkeit, in einigen Fällen sogar Halluzinationen. Nicht selten kommen neurologische Ausfälle wie Lähmungen oder Sprachstörungen sowie epileptische Anfälle und Koordinationsprobleme vor.
Bestimmte Erreger können verschiedene Gehirnareale betreffen und spezifische Symptome hervorrufen. Herpes-simplex-Enzephalitis führt zu Sprachstörungen und epileptischen Anfällen; Arbovirus-Infektionen (durch Insekten übertragene Viren) verursachen oft Bewegungsstörungen und Enteroviren können Muskelzuckungen und Zittern auslösen.
Bei der Autoimmun-Enzephalitis stehen oft neurologische und kognitive Symptome im Mittelpunkt. Verhaltensänderungen, Konzentrationsprobleme und Bewegungsstörungen treten häufig auf. Ein plötzlicher Fieberschub spricht hier eher für eine Infektion als eine autoimmune Reaktion.
Kinder und Säuglinge zeigen bei einer Enzephalitis oft unspezifische Anzeichen, wie Reizbarkeit und Teilnahmslosigkeit, Trinkschwäche, Nackensteife und Fieber sowie Krämpfe und Muskelzuckungen.
Sollten solche Symptome, besonders in Kombination, auftreten, ist eine sofortige ärztliche Untersuchung notwendig, da eine frühe Behandlung entscheidend für den Verlauf und die Prognose einer Enzephalitis ist.
editorial.facts
- In 70% der Fälle wird eine Gehirnentzündung durch Viren verursacht. Besonders häufige Auslöser sind Herpesviren und das FSME-Virus, das durch Zeckenbisse übertragen wird.
- Enzephalitis kann in jedem Alter auftreten, doch besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem, da ihr Körper Infektionen schlechter abwehren kann.
- Etwa 1% der Schildzecken in der Natur trägt das FSME-Virus. Diese Frühsommer-Meningoenzephalitis tritt vermehrt in der wärmeren Jahreszeit auf, wenn diese Milben am aktivsten sind.
- Auch Mücken können Enzephalitis-Viren übertragen. Das West-Nil-Virus, das über Mückenstiche in den Körper gelangt, tritt häufiger in den Sommermonaten auf.
Was ist die Ursache für eine Enzephalitis?
Eine Gehirnentzündung wird durch das Eindringen von Erregern oder eine fehlgeleitete Immunreaktion ausgelöst. Die häufigste Ursache sind Viren – etwa das Herpes-simplex-Virus, das West-Nil-Virus (übertragen durch Mücken) oder das FSME-Virus. Letzter wird meist durch Zecken übertragen und kann eine Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute und/oder des Rückenmarks auslösen (Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME). Auch Grippeviren können in seltenen Fällen eine Enzephalitis verursachen.
Man unterscheidet zwischen infektiöser und autoimmuner Enzephalitis. Bei einer infektiösen Enzephalitis ist eine Infektion durch Viren, Bakterien oder Pilze der Auslöser. Besonders immungeschwächte oder ältere Menschen sowie Kinder sind hier gefährdeter. Gegen viele Erreger existieren jedoch Impfungen. Bei der autoimmunen Enzephalitis hingegen greift das eigene Immunsystem versehentlich die Nervenzellen des Gehirns an und verursacht so eine Entzündung. Beispiele sind Erkrankungen wie die Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis, bei der bestimmte Antikörper gegen die Nervenzellen gebildet werden. Solche autoimmunen Prozesse können durch Infektionen, Krebserkrankungen oder seltener durch Impfstoffe ausgelöst werden.
Obwohl eine Enzephalitis viele Ursachen haben kann, bleibt sie besonders für immunschwache Personen und Kinder ein gesundheitliches Risiko. Ein rascher Beginn der Behandlung kann den Verlauf der Krankheit jedoch positiv beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Meningitis und Enzephalitis?
Der Unterschied zwischen Meningitis und Enzephalitis liegt im Bereich des Gehirns, der von der Entzündung betroffen ist. Bei einer Meningitis sind die Hirnhäute, die schützenden Hüllen des Gehirns, entzündet, während bei einer Enzephalitis das Gehirngewebe selbst betroffen ist, insbesondere das Grosshirn.
Manchmal kommt es jedoch vor, dass beide Bereiche gleichzeitig entzündet sind; in diesem Fall spricht man von einer Meningoenzephalitis. Diese Mischform kann sowohl die typischen Symptome einer Meningitis, wie Nackensteifigkeit, als auch die neurologischen Symptome einer Enzephalitis verursachen. Eine Meningitis kann in manchen Fällen in eine Enzephalitis übergehen und umgekehrt.
Welche Prognose und Folgen gibt es bei einer Enzephalitis?
Die Prognose einer Enzephalitis hängt stark vom Verlauf der Erkrankung, dem auslösenden Erreger, dem betroffenen Gehirnbereich und der allgemeinen gesundheitlichen Verfassung der betroffenen Person ab. Während eine leichte Enzephalitis oft vollständig ausheilt und keine langfristigen Folgen hinterlässt, kann eine schwere Enzephalitis zu bleibenden Schäden führen und ist oft mit einem Krankenhausaufenthalt verbunden.
In etwa einem Drittel der Fälle bleiben nach einer Enzephalitis Langzeitfolgen wie Konzentrations- oder Sprachprobleme oder sogar epileptische Anfälle zurück, da Nervenzellen zerstört wurden. Besonders bei Kindern kann es zu Entwicklungsverzögerungen kommen, und seltener auch zu einem sogenannten Hydrocephalus, einer krankhaften Ansammlung von Hirnwasser.
Die Aussichten sind abhängig vom Erreger: Während eine Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) in den meisten Fällen ohne gravierende Spätfolgen verläuft, ist bei einer Herpes-simplex-Enzephalitis das Risiko für Komplikationen erhöht. Unbehandelt verläuft diese sogar in rund 70 Prozent der Fälle tödlich; eine rechtzeitige Behandlung mit Virostatika rettet jedoch die meisten Betroffenen.
Eine seltene und besonders gefährliche Folge ist die subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE), die nach einer Maserninfektion auftreten kann und fast immer tödlich verläuft. Insgesamt gilt: Ein frühzeitiger Behandlungsbeginn kann die Prognose erheblich verbessern und die Chance auf vollständige Genesung steigern.
Kann man einer Enzephalitis vorbeugen?
Eine der wichtigsten Massnahmen ist der Schutz vor bestimmten Erregern, die eine Gehirnentzündung auslösen können. So gibt es für viele Viren, die Enzephalitis verursachen können, wirksame Impfungen, wie zum Beispiel gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken (Zoster), Kinderlähmung, FSME und Influenza. Ihr Arzt kann Sie individuell dazu beraten.
Auch vor einer Reise sollte man sich über die empfohlenen Impfungen für das jeweilige Reiseziel informieren, um das Risiko einer Enzephalitis durch exotische Viren, etwa das Japanische-Enzephalitis-Virus oder das West-Nil-Virus, zu minimieren.
Enzephalitis: Wann ist eine Impfung ratsam?
Die Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) wird Personen empfohlen, die sich in Risikogebieten aufhalten oder dort leben, da Zeckenstiche in diesen Gebieten das FSME-Virus übertragen können. Vor allem Menschen, die sich viel in der Natur aufhalten – wie Wanderer, Radfahrer, Camper, Forst- und Landarbeiter – profitieren von der Impfung. Auch in städtischen Parks und Gärten können diese Blutsauger vorkommen, so dass auch hier ein Schutz sinnvoll sein kann.
Die Grundimmunisierung besteht aus drei Dosen: Die ersten beiden Dosen im Abstand von 2-4 Wochen bieten einen ersten Schutz für die laufende Saison, die dritte Dosis 5-12 Monate später gewährleistet einen Langzeitschutz von über 95% für mindestens 10 Jahre. Auffrischimpfungen werden alle 10 Jahre empfohlen.
Idealerweise beginnt man mit der Impfserie im Winter, um für die Zeckensaison im Frühjahr geschützt zu sein. Für einen kurzfristigen Schutz, z.B. bei Reisen in Risikogebiete, kann ein Kurzschema angewendet werden, das bereits nach wenigen Wochen Immunität bietet. Die FSME-Impfung ist gut verträglich, gelegentlich treten leichte Nebenwirkungen wie Rötungen an der Einstichstelle oder Müdigkeit auf, schwere Reaktionen sind äusserst selten.
Tipps: Wie wird eine Enzephalitis behandelt?
- Eine frühzeitige Behandlung ist entscheidend, um Komplikationen und Langzeitfolgen zu vermeiden. Je früher mit der Therapie begonnen wird, desto besser sind die Aussichten auf eine vollständige Genesung.
- Eine Enzephalitis erfordert immer eine stationäre Behandlung, am besten in einem spezialisierten Krankenhaus mit neurologischer oder intensivmedizinischer Betreuung. In schweren Fällen ist eine Behandlung auf der Intensivstation notwendig.
- Bei Verdacht auf eine virusbedingte Enzephalitis, insbesondere durch Herpes-simplex- oder Varizella-Zoster-Viren, wird oft direkt mit Aciclovir behandelt, auch wenn der Erreger noch nicht bestätigt ist. Dies ist besonders wichtig, da eine unbehandelte Herpes-simplex-Enzephalitis lebensbedrohlich verlaufen kann.
- Falls die Enzephalitis durch Bakterien verursacht wird, kommen Antibiotika zum Einsatz; bei Pilzen werden pilzhemmende Mittel (Antimykotika) verabreicht.
- Bei einer durch Autoimmunprozesse ausgelösten Enzephalitis wird das Immunsystem mit hochdosierten Glukokortikoiden (Kortison) oder Immunsuppressiva unterdrückt. Zudem können Immunglobuline verabreicht oder eine Plasmapherese (Blutwäsche) durchgeführt werden, um schädliche Antikörper aus dem Körper zu entfernen.
- Bei Enzephalitis-Formen, für die es keine gezielte antivirale Therapie gibt (wie FSME), liegt der Fokus auf der Linderung der Symptome, beispielsweise mit Schmerzmitteln und Fiebersenkung.
- Epileptische Anfälle werden mit antiepileptischen Medikamenten behandelt. Bei Verhaltensstörungen oder psychischen Veränderungen können vorübergehend Antipsychotika verschrieben werden, um die Symptome zu kontrollieren.
- Strikte Bettruhe und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind essenziell für die Genesung. In schweren Fällen kann die Flüssigkeitszufuhr über Infusionen erfolgen, um den Körper zu unterstützen.
- Nach der akuten Phase können Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie hilfreich sein, um neurologische Funktionen wie Sprache, Motorik oder Gedächtnis zu verbessern.
- Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ist eine regelmässige Nachsorge wichtig, um Spätfolgen wie kognitive Beeinträchtigungen oder epileptische Anfälle frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Enzephalitis ist eine schwere Erkrankung, die das Gehirn in einen lebensbedrohlichen Ausnahmezustand versetzen kann. Eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung sind daher ebenso wichtig wie vorbeugende Massnahmen wie Impfungen und der Schutz vor Zeckenstichen. So ist die Krankheit zwar nach wie vor schwerwiegend, aber durch das Zusammenspiel von moderner Medizin und frühzeitiger Intervention können viele Betroffene mit einer positiven Prognose rechnen.