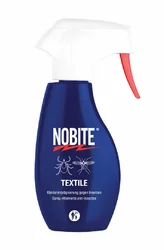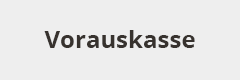Winterblues
Das hilft gegen das dunkle Stimmungstief
editorial.overview
Was passiert im Körper bei Winterblues?
Der sogenannte Winterblues, auch saisonale depressive Verstimmung oder saisonale Dysthymie genannt, ist eine Reaktion des Körpers auf die verkürzten Tage und das reduzierte Tageslicht in der kalten Jahreszeit. Die Symptome können individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein und variieren oft von Jahr zu Jahr – etwa bei einem Umzug in eine dunklere Wohnung oder nördlichere Regionen. Doch was genau passiert im Körper?
Unser Körper steuert viele seiner Funktionen über die sogenannte innere Uhr, die eng mit dem Licht-Dunkel-Rhythmus verbunden ist. Licht ist der wichtigste Taktgeber für die Produktion bestimmter Hormone. Melatonin, das Schlafhormon, wird bei Dunkelheit produziert und signalisiert dem Körper, dass es Zeit ist, sich auszuruhen. Serotonin, auch als Glücks- und Wachhormon bekannt, wird bei Helligkeit vermehrt ausgeschüttet. Es fördert gute Laune, Antrieb und geistige Wachheit. In den dunklen Wintermonaten, wenn Tageslicht rar ist, gerät dieses Gleichgewicht aus dem Rhythmus: Der Körper produziert übermässig viel Melatonin, was zu anhaltender Müdigkeit führt, und zu wenig Serotonin, was Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit begünstigt.
Die hormonellen Veränderungen wirken sich auf verschiedene Bereiche des Körpers und der Psyche aus. Typische Symptome des Winterblues sind Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, die meist ohne klaren Grund auftreten. Betroffene fühlen sich oft erschöpft und finden es schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Sie schlafen länger, haben aber Schwierigkeiten, morgens aufzustehen, und fühlen sich trotz ausreichender Schlafzeit nicht erholt. Viele greifen vermehrt zu süssen oder stärkehaltigen Lebensmitteln, was häufig eine Gewichtszunahme zur Folge hat.
Was sind Unterschiede zwischen Winterblues, Winterdepression und klassischer Depression?
Die Begriffe Winterblues, Winterdepression und klassische Depression werden häufig durcheinandergebracht, doch sie beschreiben unterschiedliche Phänomene mit eigenen Merkmalen. Während es Überschneidungen bei den Symptomen gibt, unterscheiden sie sich in Ursache, Schweregrad und Verlauf.
Der Winterblues ist keine Krankheit, sondern eine vorübergehende Verstimmung, die in den dunklen Wintermonaten auftritt. Die Symptome sind mild und verschwinden bei schönem Wetter oder in der Frühlingszeit von selbst. Sie dauern in der Regel bis zu zwei Wochen an. Etwa 20% der Bevölkerung erleben Winterblues mit seinen typischen Symptomen wie leichter Antriebslosigkeit, Stimmungstiefs und schlechter Laune, Müdigkeit und erhöhtem Schlafbedürfnis. Heisshunger auf kohlenhydratreiche Lebensmittel, insbesondere Süssigkeiten, führt oft zu Gewichtszunahme, während Betroffene das Bedürfnis verspüren, sich zurückzuziehen und weniger aktiv zu sein.
Die Winterdepression, auch saisonal abhängige Depression (SAD), ist eine anerkannte Unterform der Depression, die saisonal auftritt – meist im Herbst und Winter. Etwa 5% der Bevölkerung leiden daran, Frauen häufiger als Männer. Typische Beschwerden sind Antriebslosigkeit und starke Müdigkeit, Heisshunger auf kohlenhydratreiche Lebensmittel (oft mit Gewichtszunahme), längeres Schlafen (oft verbunden mit Erschwernis des Erwachens), Niedergeschlagenheit und emotionale Schwere sowie Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags. Die Symptome treten regelmässig in den dunklen Monaten auf und können bis ins Frühjahr hinein andauern. Sie verschwinden meist von selbst, schwerere Fälle sollten jedoch ärztlich behandelt werden.
Die klassische Depression ist eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die nicht saisonal gebunden ist und das ganze Jahr über auftreten kann. Rund 8% der Menschen erkranken einmal im Leben an einer Depression. Sie kann Wochen, Monate oder sogar Jahre andauern und bedarf in den meisten Fällen einer professionellen Behandlung. Emotionale Symptome wie Verzweiflung, Angst oder Schuldgefühle stehen oft im Vordergrund. Appetitverlust und Schlafstörungen sind sehr ausgeprägt: Bei SAD kommt es oft zu Heisshunger und Gewichtszunahme, während bei der klassischen Depression Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme typisch sind. SAD-Betroffene schlafen häufig länger und mehr, während Menschen mit einer klassischen Depression oft Schlafstörungen haben und nicht zur Ruhe kommen.
editorial.facts
- In der dunklen Jahreszeit produziert der Körper weniger Serotonin, was zu Antriebslosigkeit und einer schlechteren Stimmung führt. Eine französische Studie zeigt sogar, dass bei trübem Wetter weniger geflirtet wird.
- Trübes Wetter kann nicht nur die Laune drücken, sondern auch die Stimmung an den Finanzmärkten. Studien belegen einen Zusammenhang zwischen schlechten Wetterbedingungen und fallenden Börsenkursen.
- Der Körper versucht den Glückshormon-Mangel im Winter auszugleichen – oft durch den Griff zu Zuckerhaltigem wie Plätzchen und Süssigkeiten.
- Während südliche Länder weniger Betroffene haben, leiden in Skandinavien deutlich mehr Menschen unter Stimmungstiefs. Besonders betroffen sind Menschen, die den ganzen Tag ohne Tageslicht verbringen – morgens und abends im Dunkeln unterwegs und tagsüber in geschlossenen Räumen.
Winterblues und Winterdepression - genetisch verursacht?
Die Entstehung von Winterblues und Winterdepression wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter auch genetische. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass unsere Empfindlichkeit für Licht und Dunkelheit sowie die hormonellen Reaktionen darauf teilweise erblich bedingt sind. Dies könnte erklären, warum manche Menschen stärker betroffen sind als andere.
Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass genetische Faktoren besonders in nördlichen Regionen eine Rolle spielen könnten. Bevölkerungsgruppen wie Isländer, die in Island nahe dem 65. Breitengrad leben, und Kanadier mit isländischem Ursprung, die um den 50. Breitengrad leben, zeigen vergleichbar niedrige Raten an Winterdepressionen – trotz des geringen Tageslichts in diesen Regionen. Dies deutet darauf hin, dass genetische Anpassungen über Generationen hinweg möglicherweise dazu beigetragen haben, die Auswirkungen von Lichtmangel abzumildern. Biologisch wäre dies ein Vorteil, da die Symptome von Winterblues und Winterdepression, wie reduzierte Energie und geringere Bereitschaft zur Reproduktion, das Überleben und die Weitergabe von Genen in lichtarmen Regionen erschweren könnten.
Ein weiteres Indiz für eine genetische Beteiligung ist die familiäre Häufung von Winterblues und Winterdepressionen. Menschen, deren Verwandte betroffen sind, haben ein erhöhtes Risiko, selbst unter saisonalen Stimmungsstörungen zu leiden. Dies könnte auf eine vererbte Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen von Licht und Dunkelheit hindeuten, die sich in einer stärkeren hormonellen Reaktion, insbesondere in der Melatonin- und Serotoninproduktion, äussert.
Während Umweltfaktoren wie Tageslichtmangel eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Winterblues und Winterdepressionen spielen, deutet die Forschung darauf hin, dass genetische Faktoren diese Anfälligkeit verstärken oder abschwächen können.
Was tun Sie gegen ein Stimmungstief im Winter?
Welche Rolle spielt Melatonin bei Winterblues und Winterdepression?
Ein zentrales Merkmal von Winterblues und Winterdepression ist die vermehrte Produktion von Melatonin, dem sogenannten Schlafhormon. Dieses Hormon wird bei Dunkelheit ausgeschüttet, um den Körper auf Schlaf einzustellen. Doch im Winter, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger sind, gerät das empfindliche Gleichgewicht aus der Bahn, was zu typischen Symptomen führt. Im Winter bedeutet also weniger Tageslicht eine verstärkte Produktion von Melatonin.
Eine aufwändige Studie hat einen klaren Unterschied in der Melatoninproduktion zwischen Menschen mit und ohne Winterdepression gezeigt. Bei Menschen mit Winterdepression ist die Dauer der Melatoninausschüttung im Winter länger als im Sommer. Der entscheidende Unterschied liegt im Zeitpunkt der Beendigung der Ausschüttung: Bei Betroffenen endet die Melatoninausschüttung im Winter später als im Sommer (z. B. 5:41 Uhr im Winter vs. 5:15 Uhr im Sommer). Bei gesunden Menschen bleibt dieser Zeitpunkt unabhängig von der Jahreszeit nahezu konstant. Dies deutet darauf hin, dass die verlängerte Melatoninausschüttung den Tag-Nacht-Rhythmus bei Menschen mit Winterdepression stärker beeinflusst und zu den Symptomen beiträgt.
Melatonin reduziert die Freisetzung von Dopamin im Gehirn. Während dies therapeutisch bei Suchterkrankungen genutzt wird, hat es bei Winterdepressionen eine Schattenseite. Weniger Dopamin bedeutet weniger Freude, Zufriedenheit und Motivation – typische Symptome einer Winterdepression. Es ist denkbar, dass die verlängerte Melatoninwirkung direkt die emotionalen Symptome von Winterdepression und Winterblues verschärft.
Welche Rolle spielt Tageslicht zur Vorbeugung des Winterblues?
Eine Theorie zur Erklärung der Rolle von Tageslicht im Winterblues bezieht sich auf die Fotorezeptoren in den Augen. Diese Rezeptoren sind dafür verantwortlich, Lichtsignale ans Gehirn zu senden, die die Produktion von Melatonin – dem Schlafhormon – hemmen. Bei Menschen mit Winterdepression sind diese Rezeptoren vermutlich weniger empfindlich, wodurch das Gehirn bei gedämpftem Licht weiterhin zu viel Melatonin produziert. Ein Überschuss an Melatonin führt zu einer vermehrten Müdigkeit und trägerem Antrieb, was die Symptome des Winterblues verstärken kann.
Tageslicht wirkt als natürlicher Stimulator für die Produktion von Serotonin. Besonders in den dunklen Wintermonaten kann ausreichendes Tageslicht dazu beitragen, den Serotoninspiegel zu steigern, was eine positive Wirkung auf die Stimmung und die allgemeine Lebensenergie hat. Tageslicht trägt auch zur Regulierung des Schlafrhythmus bei und unterstützt gesunden Schlaf sowie Stressabbau.
Tipps und Tricks: Was kann man tun, um schnell aus diesem Stimmungstief zu kommen?
- Gehen Sie regelmässig an die frische Luft, idealerweise vormittags oder mittags. Ein 30-minütiger Spaziergang reicht aus, um den Hormonstoffwechsel anzuregen, die Serotoninproduktion zu unterstützen und dein Wohlbefinden zu steigern.
- Selbst an bewölkten Tagen ist das Tageslicht deutlich stärker als die Innenbeleuchtung. Gehen Sie bei fahlem Himmel ins Freie, um Ihre Stimmung zu stabilisieren und Ihren Körper mit Licht zu versorgen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin D (z.B. durch fetten Seefisch wie Lachs und Hering) und tryptophanreichen Lebensmitteln wie Nüssen, Hülsenfrüchten und Haferflocken. Vitamin D hilft dabei, den Winterblues zu bekämpfen, indem es den Hormonhaushalt unterstützt.
- Setzen Sie gezielt Tageslichtlampen ein, insbesondere am Morgen. Diese speziellen Lampen simulieren das natürliche Tageslicht und helfen, den zirkadianen Rhythmus zu stabilisieren, was das Stimmungstief im Winter lindern kann.
- Planen Sie einen Skiurlaub oder einen Aufenthalt in Regionen mit viel Schnee. Die Reflektion des Sonnenlichts im Schnee erhöht die Helligkeit und hat einen positiven Einfluss auf Ihre Stimmung.
- Beginnen Sie bereits im Herbst (September/Oktober) mit Massnahmen wie Lichttherapie oder Vitamin D-Ergänzungen, um den Winterblues vorzubeugen und Symptome zu vermeiden.
- Bewegung ist ein effektives Mittel gegen Winterdepressionen. Sie fördert die Serotoninproduktion und trägt zur Reduktion von Stress bei. Ob Spaziergänge, Radfahren oder Langlaufen – Hauptsache, es macht Ihnen Spass.
- Treffen Sie sich regelmässig mit Freunden oder Familie. Das Pflegen sozialer Kontakte kann helfen, den Winterblues zu vertreiben und die emotionale Unterstützung zu erhalten, die in der dunklen Jahreszeit so wichtig ist.
- Halten Sie Ihren Schlaf-Wach-Rhythmus so konstant wie möglich. Zu viel Schlaf verstärkt oft die Symptome der Winterdepression, während eine ausgewogene Schlafmenge erfrischend wirkt.
- Eine kognitive Verhaltenstherapie (CBT) kann besonders hilfreich sein. Sie hilft, negative Gedankenmuster zu erkennen und zu ändern, die während der Winterdepression häufig auftreten. In Studien zeigte sich, dass CBT langfristig zur Verbesserung beiträgt.
- Kalte Duschen oder Wechselduschen am Morgen regen den Kreislauf an und wirken erfrischend auf Körper und Geist. Diese Aktivität kann helfen, die Antriebslosigkeit zu überwinden und die Energie zu steigern.
- Achten Sie besonders in den Wintermonaten auf eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Omega-3-Fettsäuren ist. Eine gute Ernährung unterstützt das allgemeine Wohlbefinden und kann helfen, Stimmungstiefs zu vermeiden.
- Geben Sie Ihrem Tag Struktur, um den Herausforderungen des Wintertiefs entgegenzuwirken. Planen Sie feste Aktivitäten, sowohl beruflich als auch privat, um den Tag sinnvoll zu füllen.
- Falls die Symptome der Winterdepression stark ausgeprägt sind, kann es sinnvoll sein, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Medikamente wie selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) können die Symptome lindern und den Alltag erleichtern. Ein Arzt oder Therapeut kann Sie beraten und die geeigneten Therapieformen wie Lichttherapie, Psychotherapie oder medikamentöse Behandlung empfehlen.
Der Winterblues ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf Lichtmangel, aber durch gezielte Massnahmen wie Lichttherapie, Bewegung und eine bewusste Lebensgestaltung kann man effektiv gegensteuern und die dunklen Monate besser bewältigen.